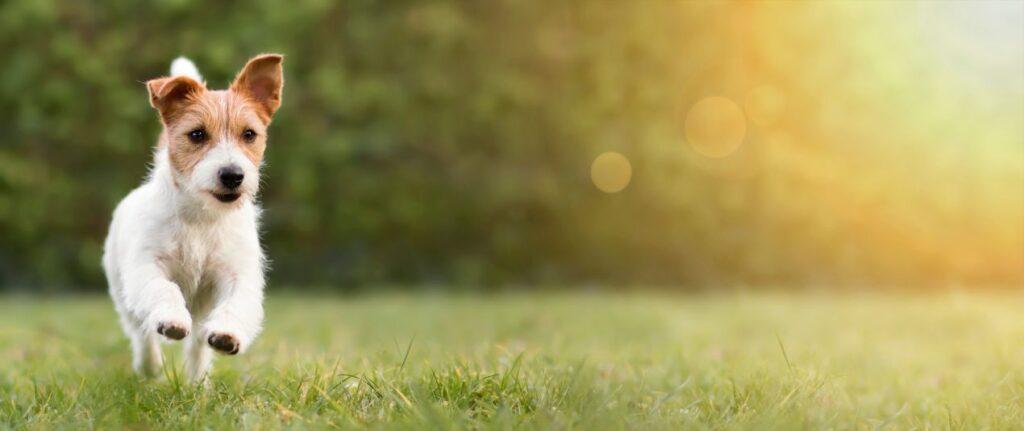Wenn ein Hund dauerhaft unter gesundheitlichen Beschwerden leidet, richtet sich der Blick schnell auf Medikamente, Tierarzttermine und Diagnosen. Doch viele übersehen, dass der Napf täglich mitentscheidet, wie gut oder schlecht es dem Tier geht. Gerade bei chronischen Erkrankungen spielt das Futter eine zentrale Rolle – nicht nur als Nahrungsquelle, sondern als aktiver Teil der Therapie. Und obwohl das Sortiment im Handel riesig ist, passt längst nicht jede Mischung zu jedem Tier.
Viele Beschwerden beginnen im Napf
Nicht jede chronische Erkrankung lässt sich allein auf die Ernährung zurückführen. Doch in vielen Fällen ist sie ein zentraler Verstärker – oder ein unterschätzter Auslöser. Hunde mit Gelenkproblemen, Hautirritationen, Niereninsuffizienz oder bestimmten Stoffwechselstörungen reagieren empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe. So kann ein zu hoher Anteil an Innereien, Fleischnebenprodukten oder bestimmten Proteinen Entzündungen fördern und Schmerzen verstärken, ohne dass die Ursache sofort klar wird.
Was die Zutatenliste nicht verrät – aber sollte
Wer Hundefutter einkauft, steht oft ratlos vor langen Zutatenlisten und wohlklingenden Produktversprechen. Begriffe wie „natürlich“, „vollwertig“ oder „ausgewogen“ sagen wenig über die tatsächliche Zusammensetzung. Entscheidend ist, wie das Futter auf den individuellen Gesundheitszustand des Hundes abgestimmt ist. Besonders bei bestehenden Diagnosen – wie Leishmaniose, Harnsteinen oder Gicht – kommt es auf Details an. Purinarmes Hundefutter wird in diesen Fällen oft empfohlen, doch was das konkret bedeutet, bleibt vielen unklar.

Purin, Proteine und der Stoffwechsel
Purin ist eine Substanz, die im Körper zu Harnsäure abgebaut wird. Bei gesunden Hunden kein Problem – bei Tieren mit bestimmten Vorerkrankungen jedoch schon. Ein dauerhaft hoher Purinspiegel kann zu schmerzhaften Ablagerungen, Organschäden oder Entzündungen führen. Deshalb spielt die Auswahl der Proteinquelle eine entscheidende Rolle. Hochwertiges Eiweiß aus Muskelfleisch ist meist besser verträglich als Innereien oder tierische Nebenerzeugnisse. Wer auf Nummer sicher gehen will, achtet auf genaue Nährwertangaben – und verzichtet auf unklare Füllstoffe.
Ernährung als Bestandteil der Therapie
Der große Vorteil einer angepassten Ernährung liegt darin, dass sie keinen zusätzlichen Stress für den Körper bedeutet. Ganz im Gegenteil: Sie kann das Tier entlasten, Beschwerden lindern und sogar helfen, Medikamente zu reduzieren. Wichtig ist, dass Futterumstellungen immer mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Einige Tiere profitieren von Spezialfutter, andere benötigen individuelle Rezepte. In manchen Fällen ist purinarmes Hundefutter die beste Option, in anderen reicht es aus, bestimmte Bestandteile zu vermeiden.
Zwischen Überforderung und Verantwortung
Viele Halter fühlen sich überfordert, wenn sie das Futter ihres Hundes selbst hinterfragen müssen. Schließlich suggerieren Werbeslogans, dass jedes Premiumprodukt auch automatisch gesund sei. Doch Hunde sind keine Einheitsmodelle. Ihr Stoffwechsel, ihr Alter und ihr Krankheitsverlauf bestimmen mit, was sie vertragen – und was eben nicht. Wer genauer hinsieht, entdeckt schnell, dass eine kleine Anpassung im Napf große Auswirkungen haben kann.

Interview: „Man muss erst verstehen, wie krank ein Hund sein kann – bevor man das Futter hinterfragt.“
Im Gespräch mit Dr. Corinna Held, Tierärztin mit Spezialisierung auf chronische Erkrankungen bei Hunden. Sie berät Tierhalter zur gezielten Ernährungstherapie und begleitet viele Patienten langfristig.
Frau Dr. Held, Sie betreuen viele Hunde mit chronischen Erkrankungen. Wie oft spielt das Futter dabei eine zentrale Rolle?
Sehr häufig. Viele Tierhalter konzentrieren sich auf Medikamente und Untersuchungen – und übersehen, dass die tägliche Ernährung ein ständiger Einflussfaktor ist. Gerade bei Stoffwechselstörungen, Nierenproblemen oder Leishmaniose wirkt sich die Zusammensetzung des Futters direkt auf das Wohlbefinden aus.
Was ist das häufigste Missverständnis, dem Sie in Ihrer Praxis begegnen?
Dass „gesundes Futter“ für alle Hunde gleich aussieht. Ein Produkt, das für den einen Hund ideal ist, kann beim nächsten zu ernsthaften Beschwerden führen. Besonders problematisch wird es, wenn der Hund chronisch krank ist – und weiterhin Futter bekommt, das nicht angepasst ist.
Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, die Sie besonders kritisch sehen?
Ja, allen voran Innereien wie Leber oder Niere. Sie enthalten viele Purine, die bei einigen Erkrankungen zu gefährlichen Stoffwechselreaktionen führen können. Ein hoher Proteingehalt ist nicht automatisch schlecht – aber die Herkunft des Proteins ist entscheidend. Deshalb empfehle ich bei bestimmten Diagnosen ganz klar purinarmes Hundefutter, obwohl das leider noch zu wenig bekannt ist.
Wie reagieren die Halter, wenn Sie Futterumstellungen empfehlen?
Anfangs oft skeptisch. Viele vertrauen auf Marken oder wollen nichts verändern, solange der Hund frisst. Aber nach einer ausführlichen Erklärung sind die meisten bereit, es zu versuchen. Und wenn nach wenigen Wochen echte Verbesserungen sichtbar sind – weniger Schmerzen, mehr Energie, bessere Blutwerte – dann sehen sie, wie viel Macht Ernährung hat.
Frau Dr. Held, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kleine Ursache, große Wirkung
Chronische Leiden beim Hund lassen sich nicht immer heilen, aber oft lindern – und genau hier beginnt Verantwortung. Wer versteht, wie stark Ernährung die Gesundheit beeinflusst, kann gezielt eingreifen, statt nur zu reagieren. Das richtige Futter ersetzt keine medizinische Behandlung, aber es kann sie sinnvoll ergänzen. Oft liegt der Schlüssel zu mehr Lebensqualität im Detail – und beginnt dort, wo man ihn nicht sofort vermutet: im Napf.
Bildnachweis: Adobe Stock/ Reddogs, Pixel-Shot, standret